Rahmenschutzkonzept
Mit einem Rahmenschutzkonzept setzen wir als Landeskirche die Standards für ein achtsames und sensibles Miteinander in unserer Kirche. Das Rahmenschutzkonzept soll alle Kirchengemeinden und Einrichtungen unserer Landeskirche dabei unterstützen, ihre Räume zu sicheren Orten für Menschen jeden Alters, insbesondere aber für Kinder und Jugendliche zu machen.
Es soll dazu dienen, dass Gewalt und sexualisierte Gewalt in unserer Landeskirche nicht verschwiegen werden und Betroffene die notwendige Hilfe und Unterstützung erfahren.
Die Erarbeitung von Schutzkonzepten für alle Bereiche unserer Kirche ist das Anliegen des Kirchengesetzes zur Prävention sexualisierter Gewalt.
Auf dieser Seite finden Sie zum Download unsere Handreichung zum Erstellen eines Schutzkonzeptes mit ausführlichen Erläuterungen, Mustertexten und Anlagen für notwendige Bausteine.
Auf der Website des Kinder- und Jugendpfarramtes finden Sie ebenfalls Informationen und Bausteine zum Erstellen eines Schutzkonzeptes.
Vor dem Hintergrund der notwendigen Bekämpfung sexualisierter Gewalt auch im Bereich der evangelischen Kirche und der Diakonie verpflichtet der kirchliche Auftrag alle in der Kirche Mitwirkenden zu einer Haltung der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit, des Respekts und der Wertschätzung sowie der grenzachtenden Kommunikation durch die Wahrung persönlicher Grenzen gegenüber jedem Mitmenschen. Die Landessynode duldet keine Form der Diskriminierung und hat ein Schutzkonzept entwickelt, das Sie ebenfalls unten auf dieser Seite finden und herunterladen können.
-
2502 Schutzkonzept - (18.08.2025 / 12 MB)
Wir wollen Kirche als lebendigen und menschenfreundlichen Ort gestalten, in dem sich das Evangelium Jesu Christi entfalten kann.
Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbilde (1. Mose 1, 26-27). Damit wird die besondere Würde eines jeden einzelnen Menschen ausgedrückt, welche aus der Beziehung zu Gott resultiert. Wir sind von Gott gewollt und geliebt und so sollen auch wir in Beziehungen zu anderen Menschen leben. Jesus würdigt in Markus 10, 13-16 besonders die Kinder, welche als Vorbild des Reiches Gottes zählen.
Wir stellen uns der Verantwortung und dem Wissen, dass es in unserer Arbeit mit Menschen im Kirchenkreis Situationen geben kann, die die Überschreitung persönlicher Grenzen begünstigen. (...)
Wir wollen Kirche als lebendigen und menschenfreundlichen Ort gestalten, in dem sich das Evangelium Jesu Christi entfalten kann.
Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbilde (1. Mose 1, 26-27). Damit wird die besondere Würde eines jeden einzelnen Menschen ausgedrückt, welche aus der Beziehung zu Gott resultiert. Wir sind von Gott gewollt und geliebt und so sollen auch wir in Beziehungen zu anderen Menschen leben. Jesus würdigt in Markus 10, 13-16 besonders die Kinder, welche als Vorbild des Reiches Gottes zählen.
Wir stellen uns der Verantwortung und dem Wissen, dass es in unserer Arbeit mit Menschen im Kirchenkreis Situationen geben kann, die die Überschreitung persönlicher Grenzen begünstigen.
Überall, wo Menschen gemeinsam arbeiten und Gemeinschaft leben, entstehen Beziehungen und Abhängigkeiten. Unsere Aufgabe ist, eine Umgebung zu gestalten, in der diese Beziehungen nicht missbraucht werden.
An allen unseren kirchlichen Orten – in der Kirche, im Gemeindehaus, in der Kindertagesstätte bis hin zum Verwaltungsamt und auf Freizeiten, sollen Menschen jeden Alters unbeschwert und angstfrei zusammenkommen können.
Dafür dient das „Schutzkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt“.
In unserem Kirchenkreis sollen Menschen einen Raum zur Begegnung miteinander und mit Gott finden.
Mit einer offenen Willkommenskultur möchten wir erreichen, dass sich alle sicher und wohl fühlen.
Wir schaffen Möglichkeiten zur Partizipation und geben Menschen die Chance ihre Persönlichkeit und ihren Glauben entdecken, entfalten und teilen zu können.
Alle Menschen haben das Recht auf Achtung und Schutz
- ihrer Würde und Selbstbestimmung
- ihrer körperlichen und seelischen Unversehrtheit.
Gemeinsam wollen wir eine Kultur des achtsamen Miteinanders und der Verantwortung schaffen. Besonders Kinder, Jugendliche und andere schutz- oder hilfebedürftige Menschen wollen wir vor Grenzübergriffen und Machtmissbrauch schützen.
Wir handeln konsequent und aktiv, wo wir Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt wahrnehmen oder von diesen erfahren. Dafür wollen wir aufmerksam sein sowie sprach- und handlungsfähig werden, um andere und uns selbst zu schützen.
Begriffsdefinition
Unter Grenzverletzungen werden Verhaltensweisen verstanden, die persönliche Grenzen überschreiten. Dazu gehören auch unabsichtliche Berührungen oder unbedachte Äußerungen.
Sexualisierte Gewalt kann in Form von bewusst grenzüberschreitendem, übergriffigem oder nötigendem Verhalten auftreten. Übergriffiges Verhalten kann z.B. in Äußerungen, Nachrichten und Fragen mit sexuellem Inhalt, Zweideutigkeiten und körperlichen Annäherungen bestehen. Nötigungen beinhalten z.B. Aufforderungen zu sexuellen Handlungen oder zum Ansehen pornographischen Materials bis hin zu Vergewaltigungen.

Die Potential- und Risikoanalyse bildet das Fundament eines jeden Schutzkonzeptes.
Die Potentialanalyse dient der Verstetigung gelungener Bedingungen und ihrer Weiter-entwicklung (Hilfefragen: Was funktioniert gut? Was ist gelungen?).
Die Risikoanalyse deckt identifizierte Risiken auf, erkennt Situationen, die ungute Gefühle erzeugen, in denen eindeutige Antworten nicht gegeben werden können und findet Lücken in der Sicherheit.
Beide dienen dazu, alle „Räume“ der Gemeinde, eines gemeindeübergreifenden Dienstes oder einer Einrichtung bewusst wahrzunehmen und auf relevante Struktureigentümlichkeiten hin zu befragen.
Diese “Räume” sind
- zwischenmenschliche Beziehungen: Welche Abhängigkeiten, Machtverhältnisse, Weisungsbefugnisse und welche vertraulichen, nicht öffentlichen Situationen gibt es?
- Kommunikationsräume: Welche Gesprächskultur haben wir? Wie ist der Umgang mit Nähe und Distanz? Welche Formen der Begrüßung oder Verabschiedung voneinander sind üblich?
- virtuelle Räume (Messenger Dienste, Internet, Social Media etc.): Wie sicher kann sich jede*r einzelne dort fühlen? Wie werden Persönlichkeitsrechte gewahrt?
- konkrete bauliche Gegebenheiten (Keller, Treppenhaus, Gruppenräume, Kirche…): Gibt es verdeckte Ecken, nicht einsehbare Bereiche?
Anhand der Ergebnisse kann festgelegt werden, welche Maßnahmen für den eigenen Bereich notwendig sind und in welcher Weise sie an besondere Begebenheiten angepasst werden müssen.
Die Leitfragen der Potential- und Risikoanalyse geben dabei Orientierung. Die Inhalte müssen den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden; ggf. sind Punkte zu ergänzen oder zu streichen. Aus der?Analyse?muss für jeden konkreten Arbeitsbereich bzw. jede Arbeitssituation das entsprechend Zutreffende genutzt und durch Ergänzungen eine konkrete Anpassung vorgenommen werden.
Die Erstellung einer Potenzial- und Risikoanalyse bildet den momentanen Ist-Zustand vor Ort ab und kann keine vollständige Sicherheit geben, dass sexualisierte Gewalt zukünftig nicht stattfinden könnte. Sie trägt jedoch dazu bei, die Gegebenheiten vor Ort genau zu betrachten sowie Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, die das Risiko weiter minimieren.
Unser Ziel ist es nach §6 KGSG eine Täter*innen-unfreundliche Umgebung zu schaffen und strukturelle Maßnahmen zur Prävention zu verstetigen. Diese Analyse soll mit allen beteiligten Mitarbeitenden durchgeführt werden. Auch Evaluationen mit Teilnehmenden helfen bei der Klärung von Potentialen und Risiken.

DOWNLOAD
-
Potential- und Risikoanalyse - (17.09.2025 / 2 MB)
Als Kirchenkreis Halle-Saalkreis der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland arbeiten wir auf Grundlage eines gemeinsamen Verhaltenskodexes.
Er mündet in eine Selbstverpflichtungserklärung aller haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden in unseren Arbeitsbereichen.
Die Selbstverpflichtungserklärung ist durch alle tätigen Personen abzugeben und bei den Zuständigen vor Ort zu hinterlegen.
Das Schutzkonzept mit seinen Unterpunkten ist in Bewerbungszusammenhängen anzusprechen, die Bewerber*innen müssen hier ihren Umsetzungswillen bekunden.
Ziel:?Durch die Selbstverpflichtungserklärung wird die Haltung zur Prävention in positiver Form manifestiert. Bei strittigen Situationen bildet diese gemeinsame Vereinbarung die Diskussionsgrundlage. Konflikten wird vorgebeugt, da alle Mitarbeitenden ein gemeinsames Regularium unterzeichnen.

DOWNLOAD
-
Verhaltenskodex und Selbstverpflichtung - (17.09.2025 / 97 KB)
Die Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses ist ein wichtiger Baustein der Präventionsarbeit. Sie verhindert, dass einschlägig vorbestrafte Personen beschäftigt werden und hat somit eine Signalfunktion. Personen, die Umgang mit Schutzbefohlenen und Zugang zu den Räumlichkeiten haben, legen zur Einsicht nach § 72 a SGB VIII ein erweitertes Führungszeugnis vor. (...)
Die Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses ist ein wichtiger Baustein der Präventionsarbeit. Sie verhindert, dass einschlägig vorbestrafte Personen beschäftigt werden und hat somit eine Signalfunktion. Personen, die Umgang mit Schutzbefohlenen und Zugang zu den Räumlichkeiten haben, legen zur Einsicht nach § 72 a SGB VIII ein erweitertes Führungszeugnis vor.
-
Das erweiterte Führungszeugnis darf bei Vorlage nicht älter als 3 Monate sein. Im Abstand von jeweils 3 Jahren nach Vorlage ist erneut ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis vorzulegen, wozu die*der Mitarbeitende jeweils rechtzeitig aufgefordert werden soll. Der notwendige Antrag wird vom Träger entsprechend vorbereitet zur Verfügung gestellt.
-
Das erweiterte Führungszeugnis ist nach Einsichtnahme an die vorlagepflichtige Person zurückzugeben; Kopien dürfen nicht angefertigt werden.
-
Die Einsichtnahme des erweiterten Führungszeugnisses ist gemäß § 72a SGB VIII zu dokumentieren.
Sollte eine rechtskräftige Verurteilung nach den in § 72a SGB VIII genannten Straftaten aufgeführt sein, darf die Person die haupt-, neben- oder ehrenamtliche Tätigkeit nicht aufnehmen.
Hauptamtliche Mitarbeitende
Beschäftigte im Sinne von § 30a Absatz 1 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) haben zum Nachweis der persönlichen Eignung ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a i. V. m. § 32 Absatz 5 BZRG/§ 72a SGB VIII zu beantragen und dem Arbeitgeber vorzulegen. Der Nachweis der persönlichen Eignung gilt als erbracht, wenn aus dem Führungszeugnis keine Eintragungen von Straftaten nach § 72a Absatz 1 SGB VIII hervorgehen. Das Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierte Gewalt regelt dies mit § 5 und ist verpflichtend.
Bei Neueinstellungen hat die Vorlage grundsätzlich vor Beschäftigungsbeginn zu erfolgen.
Die Kosten für die Führungszeugnisse trägt der Arbeitgeber, mit Ausnahme bei Erstvorlage vor Aufnahme einer Tätigkeit.
Der Arbeitgeber/Träger speichert den Umstand der Einsichtnahme, das Datum des Führungszeugnisses und die Information, dass es keine Eintragungen von Straftaten nach § 72a Absatz 1 SGB VIII gibt.
Die Originale der Führungszeugnisse werden von den Beschäftigten aufbewahrt und sind auf Verlangen des Arbeitgebers erneut vorzulegen.
Neben- und ehrenamtliche Mitarbeitende
Neben- und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Arbeit mit Schutzbefohlenen sind in geeigneter Form auf ihre Verantwortung für die Wahrung des Wohls der Schutzbefohlenen hinzuweisen.
Dazu dienen regelmäßige Schulungen zur Prävention von sexualisierter und sonstiger Gewalt und die Unterzeichnung einer schriftlichen Selbstverpflichtungserklärung auf Grundlage des gültigen Verhaltenskodexes.
Darüber hinaus muss die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 30a BZRG verlangt werden, wenn Art, Intensität und Dauer des Kontaktes in der Arbeit mit Schutzbefohlenen dies nahelegen:
- Der*die Mitarbeitende wird betreuend oder erzieherisch tätig und diese Aufgabe voraussichtlich selbständig oder zumindest teilweise selbständig wahrnehmen.
- Die Art der Veranstaltung führt üblicherweise zu intensiveren und längeren Kontakten, die geeignet sind, ein Vertrauensverhältnis zwischen den Mitarbeitenden als Betreuende und den Minderjährigen als Betreute zu begründen.
- Die Art und die Dauer der Veranstaltung sind geeignet, ein Beziehungsverhältnis zu befördern, das ein Abhängigkeitsverhältnis begründen kann
Für Freizeiten, Fahrten, Camps mit Übernachtung gilt:
- Volljährige Mitarbeitende haben ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen.
- Mitarbeitende zwischen 14 und 18 Jahren legen ein erweitertes Führungszeugnis vor, wenn der Altersunterschied zwischen ihnen und dem jüngsten zu betreuenden Teilnehmenden drei Jahre übersteigt oder sie mit der persönlichen Betreuung einzelner Minderjähriger beauftragt werden sollen.
- Ein spontanes ehrenamtliches Engagement für einen überschaubaren Zeitraum bedarf in der Regel keiner Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses soweit besondere Gründe nicht gegen diese Handhabung sprechen.
Für die Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen gilt:
- Volljährige Mitarbeitende, die regelmäßig über einen längeren Zeitraum eigenverantwortlich eine Gruppe leiten, legen ein erweitertes Führungszeugnis vor.
- Beträgt der Altersunterschied des Mitarbeitenden zum jüngsten zu betreuenden Teilnehmenden höchstens drei Jahre, kann von der Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses abgesehen werden.2
Die Notwendigkeit kann mit Hilfe des Prüfbogens durch den zuständigen Träger eingeschätzt werden.
Bescheinigung und Kosten
Die Aufforderung zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses ist der bzw. dem Neben-/ Ehrenamtlichen schriftlich zu bescheinigen. Dabei ist zu bestätigen, dass die Voraussetzungen zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 30a BZRG vorliegen. Soweit keine andere Regelung getroffen ist oder die Gebührenbefreiung nach § 12 JVKostO nicht greift, trägt der Kirchenkreis bzw. die Gemeinde die Kosten des erweiterten Führungszeugnisses.

DOWNLOAD
-
Antrag Führungszeugnis Ehrenamt - (17.09.2025 / 364 KB)
-
Prüfschema Führungszeugnis - (17.09.2025 / 114 KB)
Ein weiterer wichtiger Baustein präventiver Arbeit sind verpflichtende Fortbildungen für haupt-, neben- und ehrenamtlich Mitarbeitende zum Thema “Schutz vor sexualisierter Gewalt”.
Ziel der Fortbildungen ist es, die Mitarbeitenden zu sensibilisieren und Handlungskompetenz im Umgang mit sexualisierter Gewalt zu vermitteln.
Um eine „Kultur des Hinschauens und Handelns“ zu etablieren, braucht es sowohl Hintergrundwissen als auch die Bereitschaft, sich mit der eigenen Haltung auseinanderzusetzen. Im Konfliktfall können Mitarbeitende den Betroffenen mit Verständnis und Sensibilität begegnen.
Die Schulungen befähigen, mögliche Gefährdungen zu erkennen, und tragen dazu bei, Handlungsfähigkeit herzustellen. (...)
Ein weiterer wichtiger Baustein präventiver Arbeit sind verpflichtende Fortbildungen für haupt-, neben- und ehrenamtlich Mitarbeitende zum Thema “Schutz vor sexualisierter Gewalt”.
Ziel der Fortbildungen ist es, die Mitarbeitenden zu sensibilisieren und Handlungskompetenz im Umgang mit sexualisierter Gewalt zu vermitteln.
Um eine „Kultur des Hinschauens und Handelns“ zu etablieren, braucht es sowohl Hintergrundwissen als auch die Bereitschaft, sich mit der eigenen Haltung auseinanderzusetzen. Im Konfliktfall können Mitarbeitende den Betroffenen mit Verständnis und Sensibilität begegnen.
Die Schulungen befähigen, mögliche Gefährdungen zu erkennen, und tragen dazu bei, Handlungsfähigkeit herzustellen.
Unsere Mitarbeitenden sind entsprechend ihren Aufgaben in Haupt-, Neben- und Ehrenamt über Verfahrenswege dieses Konzeptes fortgebildet.
Fortbildungen sollen in regelmäßigen Abständen angeboten und wahrgenommen werden.
Angebote für Fortbildungen:
Veranstaltungen - Evangelische Jugend EKM
Jugendleiter*innen-Ausbildung (JuLeiCa) – Villa Juehling
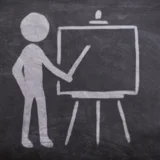
Als ein zentraler Schlüssel im Kinderschutz gilt die Partizipation. Unter Partizipation wird die altersgerechte Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in alle das Zusammenleben betreffenden Ereignisse und Entscheidungsprozesse verstanden.
Kinder und Jugendliche lernen, ihre Gefühle und Bedürfnisse zu artikulieren. Sie müssen im Rahmen einer wirkungsvollen Partizipation die Möglichkeit haben, sich an Diskussions- und Entscheidungsprozessen innerhalb der Einrichtung / der Gruppe zu beteiligen, ihre Interessen einbringen zu können und Gehör zu finden.
So ist es ratsam, auch im Rahmen der Potential- und Risikoanalyse Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene als Expert*innen ihrer eigenen Sache zu befragen und sie zu beteiligen, welche Potentiale und Gefährdungen sie selbst wahrnehmen. (...)
Als ein zentraler Schlüssel im Kinderschutz gilt die Partizipation. Unter Partizipation wird die altersgerechte Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in alle das Zusammenleben betreffenden Ereignisse und Entscheidungsprozesse verstanden.
Kinder und Jugendliche lernen, ihre Gefühle und Bedürfnisse zu artikulieren. Sie müssen im Rahmen einer wirkungsvollen Partizipation die Möglichkeit haben, sich an Diskussions- und Entscheidungsprozessen innerhalb der Einrichtung / der Gruppe zu beteiligen, ihre Interessen einbringen zu können und Gehör zu finden.
So ist es ratsam, auch im Rahmen der Potential- und Risikoanalyse Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene als Expert*innen ihrer eigenen Sache zu befragen und sie zu beteiligen, welche Potentiale und Gefährdungen sie selbst wahrnehmen.
Sie müssen informiert werden, welche Vorgehensweise es in Verdachtsfällen in ihren Gruppen und Angeboten gibt. Dabei ist von zentraler Bedeutung, dass alle Kinder, Jugendlichen und anderen Schutzbefohlenen wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie einen Verdacht haben oder selbst Opfer eines Übergriffs wurden.
Fragen und Anregungen zur Partizipation (Beteiligung) von Kindern und Jugendlichen
- Können sie die Angebote und den Alltag mitbestimmen und mitgestalten?
- Wie werden Regeln aufgestellt und kommuniziert?
- Gibt es Strukturen für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen z.B. als Gruppensprecher*innen?
- Wird ihnen regelmäßig Gelegenheit gegeben, über Themen zu sprechen, die für sie relevant sind?
- Ist die Gesprächsatmosphäre in ihren Angeboten so vertrauensvoll, dass sie wissen, dass es keine Tabu-Themen gibt?
- Wird in Gruppen und Angeboten regelmäßig darüber gesprochen:
- welche Gefährdungen sie wahrnehmen,
- was für sie Grenzverletzungen sind,
- ob sie allgemein Probleme im Gruppengeschehen und in der Interaktion zwischen Teilnehmenden und Mitarbeitenden wahrnehmen?
- Sind den Teilnehmenden Informationen über Hilfe und Beratung bekannt und sind die dahinterstehenden Entscheidungsprozesse auch für sie transparent?
- Sind Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte und Mitarbeitende über ihre Rechte informiert worden – und zwar so, dass sie diese Rechte verstehen und wissen, wo sie Unterstützung erhalten?

Unter Prävention verstehen wir alle sinnvollen Maßnahmen, die zur Vorbeugung, Verhinderung und Beendigung von sexueller Gewalt beitragen. Dabei ist es uns wichtig, dass Kinder, Jugendliche und andere Schutzbefohlene mit den Präventionsgrundsätzen vertraut sind. Diese dienen zur Wissensvermittlung und Stärkung. (...)
Unter Prävention verstehen wir alle sinnvollen Maßnahmen, die zur Vorbeugung, Verhinderung und Beendigung von sexueller Gewalt beitragen. Dabei ist es uns wichtig, dass Kinder, Jugendliche und andere Schutzbefohlene mit den Präventionsgrundsätzen vertraut sind. Diese dienen zur Wissensvermittlung und Stärkung.
Präventionsgrundsätze in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
- Es gibt angenehme und unangenehme Gefühle und diese dürfen ausgedrückt werden. Es gibt „komische“ Gefühle, die positiv und negativ zugleich sein können.
- Ebenso gibt es gute und schlechte Geheimnisse. Schlechte Geheimnisse machen unangenehme Gefühle und dürfen (sollten) weitergesagt werden. Das ist kein Verpetzen.
- Jeder Mensch hat das Recht „nein“ zu sagen, wenn etwas geschieht, was unangenehme Gefühle erzeugt.
- Jeder Mensch darf über sich selbst bestimmen.
- Niemand darf mir wehtun.
- Niemand darf meinen Körper berühren, wenn ich es nicht möchte.
Wenn es trotzdem jemand macht, ist es Gewalt. - Niemand darf mich beleidigen oder mit Worten verletzen.
Wenn es trotzdem jemand macht, ist es Gewalt. - Niemand darf mich zu Handlungen zwingen, die mir unangenehm sind.
Wenn es trotzdem jemand macht, ist es Gewalt.
- Es gibt körperliche, seelische und sexualisierte Gewalt. Täter*innen kommen meist aus dem Umfeld der Betroffenen. Erwachsene haben die Aufgabe, sensibel hinzuhören, wenn Kinder und Jugendliche diesbezüglich etwas erzählen.
Unsere Präventionsmaßnahmen beinhalten:
- Regelmäßige Mitarbeitenden Schulungen
- Persönlichkeitsstärkende Arbeit mit einem hohen Maß an Partizipation
- Arbeit nach den Präventionsgrundsätzen
- Sensibilität für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt mit dem Ziel grenzachtender Bildungsangebote zur Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung
- Schaffen einer Täter*innen-unfreundlichen Umgebung
Arbeitsmaterial für die Arbeit mit Kindern:
„Kinder dürfen nein sagen!“ – in sieben Sprachen (caritas.de)

Ansprechstelle der EKM
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland bietet Betroffenen, die sexualisierte Gewalt im kirchlichen Bereich erfahren mussten, Beratung und Unterstützung an. Alle Gespräche sind vertraulich und unterliegen der seelsorgerlichen Schweigepflicht. (...)
Ansprechstelle der EKM
Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland bietet Betroffenen, die sexualisierte Gewalt im kirchlichen Bereich erfahren mussten, Beratung und Unterstützung an. Alle Gespräche sind vertraulich und unterliegen der seelsorgerlichen Schweigepflicht.
Die Aufgaben der Ansprechstelle sind u.a.:
-
Beratung in Fragen der Prävention, Intervention, Unterstützung und Aufarbeitung sowie Koordinierung entsprechender Maßnahmen
-
Unterstützung bei Vorfällen sexualisierter Gewalt
-
Beratung Betroffener und Bearbeitung der Anträge auf Leistungen zur Anerkennung erlittenen Unrechts
-
Unterstützung bei der Präventionsarbeit, insbesondere durch die Implementierung und Weiterentwicklung von Schutzkonzepten
-
Erarbeitung von Informationsmaterial sowie Aus-, Fort- und Weiterbildungen zur Prävention
Bitte setzen Sie sich in Verbindung mit:
Pfarrerin Dorothee Herfurth-Rogge
Telefon:?0345 68669854
Mobil:?0172 7117672
Mail: dorothee.herfurth-rogge@ekmd.de
 Gemeinsame Meldestelle
Gemeinsame Meldestelle
In Kirche und Diakonie gilt das?Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, in dem geregelt ist, was unter sexualisierte Gewalt verstanden wird und wie Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene vor dieser geschützt werden können.
Liegt ein Verdacht vor, müssen kirchliche und diakonische Mitarbeitende Vorfälle sexualisierter Gewalt oder Verstöße gegen das Abstinenzgebot melden (§4 Abs. 2 des Gewaltschutzgesetzes der EKM). Um dieser Meldepflicht gerecht zu werden, haben die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, die Landeskirche Anhalt und die Diakonie Mitteldeutschland eine gemeinsame Meldestelle eingerichtet.
Haben Mitarbeitende einen Verdacht hinsichtlich der Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung, so wenden sie sich an die Meldestelle. Dort werden Wahrnehmungen und Beobachtungen ernst genommen. Die Meldestelle berät und unterstützt bei der Einschätzung der Verdachtsmomente und klärt über die nächsten notwendigen Schritte auf.
Die Meldestelle wahrt die Vertraulichkeit der Identität hinweisgebender Personen und sorgt dafür, dass Meldungen bearbeitet und notwendige Maßnahmen der Intervention und Prävention veranlasst werden.
Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) „Kind im Zentrum"
Juristenstraße 12
06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon: 03491 45938-82
meldestelle.kiz-wittenberg@ejf.de
Zentrale Anlaufstelle.help
Die zentrale Anlaufstelle.help (bundesweit kostenlos erreichbar) richtet sich an Betroffene, ihre Angehörigen und Bekannten, haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeitende, Zeugen und Zeuginnen von sexualisierter Gewalt innerhalb der evangelischen Kirche sowie an Interessierte.
Die Mitarbeitenden unterliegen der Schweigepflicht.
Fachkompetenz und Unabhängigkeit prägen das Angebot.
Die Zentrale Anlaufstelle.help vermittelt auf Wunsch an kirchliche und diakonische Ansprechstellen weiter, informiert aber auch über alternative und unabhängige Beratungsangebote.
Zentrale Anlaufstelle.help
Tel. 0800 5040112
zentrale@anlaufstelle.help
www.anlaufstelle.help
Hilfetelefon sexueller Missbrauch
Das „Hilfetelefon Sexueller Missbrauch“ ist die bundesweite, kostenfreie und anonyme Anlaufstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt, für Angehörige sowie Personen aus dem sozialen Umfeld von Kindern, für Fachkräfte und für alle Interessierten. Es ist eine Anlaufstelle für Menschen, die Entlastung, Beratung und Unterstützung suchen, die sich um ein Kind sorgen, die einen Verdacht oder ein „komisches Gefühl“ haben, die unsicher sind und Fragen zum Thema stellen möchten.
Die Frauen und Männer am Hilfetelefon sind psychologisch und pädagogisch ausgebildet und haben langjährige berufliche Erfahrung im Umgang mit sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen. Sie hören zu, beraten, geben Informationen und zeigen – wenn gewünscht – Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung vor Ort auf.
Jedes Gespräch bleibt vertraulich. Der?Schutz der persönlichen Daten?ist zu jedem Zeitpunkt garantiert.
Hilfetelefon Sexueller Missbrauch
www.hilfetelefon-missbrauch.de
0800 22 55 530
bundesweit, kostenfrei und anonym

Der Begriff „Intervention“ stammt vom lateinischen Wort „intervenire“ ab, was „sich einschalten, dazwischentreten“ bedeutet.
Bei einer Intervention handelt es sich um ein geplantes und gezieltes Eingreifen, um Störungen, Probleme oder Beschwerden über Grenzverletzungen, Verdachtsfälle oder gar Vorfälle sexualisierter Gewalt aufzudecken, zu beheben oder ihnen vorzubeugen. (...)
Der Begriff „Intervention“ stammt vom lateinischen Wort „intervenire“ ab, was „sich einschalten, dazwischentreten“ bedeutet.
Bei einer Intervention handelt es sich um ein geplantes und gezieltes Eingreifen, um Störungen, Probleme oder Beschwerden über Grenzverletzungen, Verdachtsfälle oder gar Vorfälle sexualisierter Gewalt aufzudecken, zu beheben oder ihnen vorzubeugen.
Es wird zwischen folgenden Formen sexualisierter Gewalt unterschieden:
-
Grenzverletzungen werden unabsichtlich verübt und resultieren aus fachlichen bzw. persönlichen Unzulänglichkeiten oder einer „Kultur der Grenzverletzungen“.
-
Übergriffe sind Ausdruck eines unzureichenden Respekts gegenüber Menschen, grundlegender fachlicher Mängel und/oder einer gezielten Desensibilisierung im Rahmen der Vorbereitung eines sexuellen Missbrauchs/ eines Machtmissbrauchs.
-
Strafrechtlich relevante Formen sexualisierter Gewalt sind „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ (gem. §§ 174 ff. StGB) wie z.B. sexueller Missbrauch, Erpressung/(sexuelle) Nötigung.
Damit die Handlungsfähigkeit im jeweiligen Fall gesichert ist, gibt es folgende Verfahrenswege:
- Für Meldungen und Beschwerden gibt es bestimmte Anlaufpunkte. (Beschwerdeverfahren)
- Beschwerden können auch bei Mitarbeitenden und im Seelsorgekontext geäußert werden. Zu einen guten Umgang in solchen Situationen verhilft das Beschwerdemanagement. (Beschwerdemanagement)
- Verdachtsfälle oder konkrete Vorfälle müssen bearbeitet werden und können eine Intervention notwendig machen. Um dies richtig einzuschätzen, helfen Regelungen zur Intervention (Interventionsleitfaden)
- Meldungen, Beschwerden, Verdachts- und Vorfälle müssen dokumentiert werden Sie können auch anonym erfolgen. (Falldokumentation)
1. Beschwerdeverfahren
Je nach Art des Anliegens stehen verschiedenen Anlaufstellen zur Verfügung:
1.1 Unzufriedenheit oder bei Problemen
Im Falle einer Beschwerde, z.B. bei Unzufriedenheit mit einer Situation, dem Verhalten anderer, Kritik an Entscheidungen oder bei Problemen, hat jede Person die Möglichkeit auf kurzem Weg ihr Anliegen mitzuteilen.
Hilfesuchende können sich an folgende Personen wenden:
- Mitarbeitende in der Gemeinde
- an die/den Kreisreferent*in für die Arbeit mit Kindern, Familien und Jugendlichen
- an die/den Superintendent*in des Kirchenkreises Halle-Saalkreis.
Kontaktdaten:
1.2 Verdacht hinsichtlich der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung
Haben Mitarbeitende einen Verdacht hinsichtlich der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung, so wenden sie sich an die Meldestelle. Dort werden Wahrnehmungen und Beobachtungen ernst genommen. Die Meldestelle berät und unterstützt bei der Einschätzung der Verdachtsmomente und klärt über die nächsten notwendigen Schritte auf.
Die Meldestelle (siehe 1.3.) wahrt die Vertraulichkeit der Identität hinweisgebender Personen und sorgt dafür, dass Meldungen bearbeitet und notwendige Maßnahmen der Intervention und Prävention veranlasst werden.
1.3 Vorfall oder begründeter Verdacht
Liegt ein Fall oder ein begründeter Verdacht vor, müssen kirchliche und diakonische Mitarbeitende solche Vorfälle sexualisierter Gewalt oder Verstöße gegen das Abstinenzgebot melden (§4, Absatz 2 des Gewaltschutzgesetzes). Um dieser Meldepflicht gerecht zu werden, haben die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, die Landeskirche Anhalt und die Diakonie Mitteldeutschland eine gemeinsame Meldestelle eingerichtet. Außerdem existiert die Ansprechstelle der EKM zum Schutz vor sexualisierter Gewalt für Betroffene, die sexualisierte Gewalt im kirchlichen Bereich erfahren mussten.
2. Beschwerdemanagement
Wie verhalte ich mich als Mitarbeitende*r, wenn eine Person bei mir eine Beschwerde loswerden möchte?
Das Beschwerdemanagement ist eine der tragenden Säulen für die Umsetzung der Rechte von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen.
Dabei werden Beschwerden als Impulse für die Weiterentwicklung der Arbeit betrachtet. Außerdem werden Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene dazu ermutigt, ihre Wahrnehmung der Situation zu schildern und sich zu äußern, wenn sie eine Grenzverletzung erleben.
Niemand wird wegen einer Beschwerde benachteiligt, diffamiert oder in sonstiger Art und Weise unter Druck gesetzt. Die Mitarbeitenden sind verpflichtet Beschwerden zu dokumentieren, zu prüfen und sich auf entsprechende Änderungsmöglichkeiten einzulassen.
Gute Erreichbarkeit, umfassende Information, Interesse, Aufmerksamkeit, Verständnis und eine alters- und entwicklungsangemessene Sprache sowie eine schnelle Reaktion sind wesentliche Aspekte des Beschwerdemanagements. Möglichkeiten zur Beschwerde sind das Gespräch zwischen Hilfesuchenden und den betreffenden Mitarbeitenden, einer von ihr*ihm selbst gewählten Vertrauensperson oder einer benannten zuständigen Person (Meldestelle etc.). Eine Beschwerde kann auch schriftlich erfolgen. Beschwerden können persönlich, anonym oder als Gruppe vorgetragen werden.
Beschwerde aufnehmen
- Die Aufnahme der Beschwerde erfolgt durch die Person, an die die*der Hilfesuchende sich gewandt hat. Die Zuständigkeit für die jeweilige Beschwerdebearbeitung innerhalb der Einrichtung wird geklärt.
- Für das Gespräch wird ein störungsfreier Raum gesucht und ausreichend Zeit eingeräumt.
- Dabei wird durch aktives Zuhören und offenes Fragen die Beschwerde möglichst genau erfasst und wahrgenommen.
- Der*dem Hilfesuchenden wird für seine bzw. ihre Offenheit gedankt.
- Gemeinsam werden Lösungsmöglichkeiten überlegt und sofort oder in weiteren Gesprächen erörtert.
- Bei Schritten, die Hilfesuchende selbst zur Lösung unternehmen können, wird nach Wunsch und bei Bedarf Unterstützung gegeben.
- Schritte, die im Verantwortungsbereich der Mitarbeitenden liegen, werden gegenüber der*dem Hilfesuchenden eindeutig benannt. In solchen Fällen übernimmt die angesprochene Person das weitere Vorgehen, einschließlich der Weiterleitung der Beschwerde in Absprache und mit Information der*des Hilfesuchenden.
- Bei Anzeichen sexualisierter Gewalt oder anderer Formen von Kindeswohlgefährdung muss sofort zum Wohl des Kindes oder der*des Jugendlichen gemäß Interventionsplan gehandelt werden. Die angesprochene Person ist zur Weiterleitung an die Leitungsperson/ Vertrauensperson verpflichtet. Die Verantwortung für das weitere Vorgehen liegt bei der Superintendentin / dem Superintendenten.
- Bei Fällen von Kindeswohlgefährdung oder sexualisierter Gewalt werden mit Zustimmung des Kindes oder der*des Jugendlichen die Personensorgeberechtigten über die Beschwerde informiert und auch mit ihnen wird das weitere Vorgehen abgesprochen.
- Möchten Schutzbefohlene nicht mit der Person, die sie zuerst aufgesucht haben, weitersprechen, so wird mit ihnen nach einer Person gesucht, der sie vertrauen können.
Beschwerden zu Interaktionen
Betrifft die Beschwerde eine Interaktion mit Mitarbeitenden, ohne dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, so ist gemeinsam mit dem Kind oder der*dem Jugendlichen abzuwägen, ob er*sie selbst, ggf. unter Hinzuziehung einer Vermittlungsperson, mit der betreffenden Person sprechen kann.
Ist dies nicht möglich, kann die die Beschwerde aufnehmende Person mit der*dem Betreffenden, eventuell auch unter Anonymisierung der Beschwerdeführenden Person, sprechen.
Beschwerden zu Gestaltung und organisatorischen Abläufen
Beschweren sich Schutzbefohlene über organisatorische Abläufe oder die Gestaltung des Angebots, so sind deren Vorschläge aufzunehmen, an die zuständigen Mitarbeitenden weiterzugeben und ggf. in Veränderungen einfließen zu lassen.
Nicht jede Beschwerde und jeder Veränderungswunsch entspricht dem pädagogischen Konzept der Einrichtung. Dementsprechend kann nicht jeder Wunsch von Beschwerdeführenden aufgegriffen werden. Die Auseinandersetzung auf der pädagogischen Ebene ist notwendig und eine inhaltliche Begründung ist zu geben.
Betreffen die angesprochenen Inhalte weitere Kinder, Jugendliche oder andere Schutzbefohlene, so werden auch deren Beschwerden und Vorschläge erfasst und einbezogen. Das Vorgehen der Bearbeitung von Beschwerden ist zeitlich und inhaltlich stets transparent zu halten. Änderungen im Bearbeitungsablauf müssen den Betreffenden mitgeteilt werden.
Lösungen und Antworten werden den Beteiligten von der aufnehmenden Person oder gegebenenfalls von der Leitung mitgeteilt. Dabei müssen Entscheidungen und Vorgehensweisen nachvollziehbar erklärt werden. Sind die Beschwerdeführenden nicht einverstanden, werden weitere Lösungen gesucht.
Die Umsetzung der gefundenen Lösung und die Zufriedenheit der Kinder, Jugendlichen oder anderen Schutzbefohlenen und ggf. der Personensorgeberechtigten wird unmittelbar nach der Veränderung und zu einem weiteren, späteren Zeitpunkt erfragt, auch wenn die Beschwerde erledigt scheint.
Bezüglich schriftlich abgegebener Beschwerden ist entsprechend vorzugehen. Haben Schutzbefohlene ihren Namen bekannt gegeben, so wird von der für die Beschwerde zuständigen Person ein Gespräch mit ihnen geführt, sofern sie zustimmen.
Eine Überprüfung auf Veränderung erfolgt nach einem angemessenen Zeitraum. Anonymen Beschwerden wird ebenfalls nachgegangen.
3. Interventionsleitfaden bei Verdachtsfällen sexualisierter Gewalt
3.1 Grundsätze
Wir handeln:
- im Sinne der betroffenen Person und zu ihrem Schutz
- unvoreingenommen und nicht parteiisch
- ruhig und überlegt
- direkt eingreifend, wenn Gefahr im Verzug ist
- mit schriftlicher Dokumentation in einem Verdachtstagebuch, in dem die Situation dezidiert und kleinteilig aufgezeichnet wird
- kollegial und nicht allein, d.h. mit Unterstützung einer Vertrauensperson aus dem Team, der Meldestelle oder der Leitung (im Falle eines Irrtums ist die Rehabilitation einer Person bei zu vielen Involvierten schwer möglich)
3.2 Interventionsleitfaden
Ruhe bewahren, entschleunigen und Situation analysieren!
- Reflektieren Sie die eigene Rolle und die eigenen Gefühle.
- Führen Sie ein Verdachtstagebuch (Was beobachten Sie? Welche Signale? Wann / seit wann? Wer? Wie häufig?).
- Kein Aktionismus! Sprechen Sie nicht mit den vermuteten Tätern oder den Sorgeberechtigten der*des Betroffenen. Das macht u. U. die Situation für die*den Betroffene*n nur noch schwieriger.
- Schätzen Sie ein, wie sicher oder gefährdet der*die Betroffene aktuell ist. Nur bei akuter Gefahr müssen Sie sofort eingreifen. Zuvor sollte eine Telefonberatung mit dem*der Ansprechpartner*in der Landeskirche in Anspruch genommen werden.
- Bleiben Sie klar an der Seite des*der Betroffenen, aber ohne eine Vorverurteilung des*der Beschuldigten.
Situationsanalyse überprüfen! - Führen Sie ein vertrauliches Gespräch über die Beobachtung mit anderen Mitarbeitenden, die ebenfalls mit der*dem Betroffenen arbeiten.
- Suchen Sie Gespräche mit Vertrauenspersonen des Kirchenkreises oder der Landeskirche.
- Überlegen Sie gemeinsam, ob sich ein ausreichender Verdacht bestätigt und was die notwendigen nächsten Schritte sind.
- Wenn ein begründeter Verdacht im kirchlichen Kontext besteht, informieren Sie umgehend Ihre Superintendentin / Ihren Superintendenten.
Hilfe organisieren! - Handelt es sich bei der*dem Betroffenen um eine*n Minderjährige*n, holen Sie professionelle Hilfe von den Kinderschutzdiensten oder vom Jugendamt.
- Hat sich Ihnen ein Kind anvertraut, bitte das gesamte Vorgehen mit ihm altersgerecht besprechen. Suchen Sie sich dafür ggfs. fachliche Hilfe. Es ist wichtig, dass eine Person als spezielle Vertrauensperson direkt an der Seite des Kindes bleibt.
- Erstatten Sie keine Strafanzeige ohne Zustimmung des*der Betroffenen.
3.3 Besonderheiten und Verhalten in der Seelsorge
Prüfen Sie, ob es sich bei dem Gespräch um ein Beichtgespräch, ein seelsorgerliches Gespräch oder um ein Beratungsgespräch handelt. Beachten Sie die entsprechenden Regelungen der Verschwiegenheit. Nehmen Sie die Betroffenen ernst und glauben Sie ihnen das Erzählte, auch wenn es „wirr“ erscheint.
- Versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten können.
- Schaffen Sie Rollenklarheit für sich selbst und die Betroffenen.
- Erkennen Sie die Grenzen der Seelsorge. Sie sind kein*e Therapeut*in und schon gar nicht Trauma-Therapeut*in.
- Bedenken Sie, dass die Opfer oft in einer schwierigen Verquickung mit den Tätern und Täterinnen leben.
- Holen Sie sich Hilfe bei Menschen, die ebenfalls an die seelsorgerliche Schweigepflicht gebunden sind. Sorgen Sie dafür, dass Sie trotz dieser Besprechungen die Schweigepflicht nicht verletzen. (Anonymisierung des Falles; nicht mit Personen besprechen, die möglicherweise die Betroffenen oder die Täter*innen kennen)
- Machen Sie sich von allen Gesprächen Notizen. Eine genaue Dokumentation hilft:
- falls es zur Strafanzeige kommt, als Argumentationsmittel,
- falls es zum Antrag auf Entschädigung kommt, als „Beweismittel“ für die geschädigte Person,
- falls Sie selbst plötzlich verdächtigt werden, weil das Opfer etwas auf Sie projiziert, als Schutz.
- Bewahren Sie diese Falldokumentation verschlossen auf.
- Die betroffene Person entscheidet, welche Hilfe sie braucht.
- Begleiten Sie die Person auf ihrem Weg, zeigen Sie Hilfsmöglichkeiten auf (Therapien, Opferverbände), aber bestimmen Sie diesen Weg nicht.
- Wenn die Tat noch nicht verjährt ist, überlegen Sie gemeinsam die Möglichkeit einer Strafanzeige und zeigen Sie die Konsequenzen auf, die sich aus dieser Entscheidung ergeben. Holen Sie sich ggf. den Fachverstand der Beratungsstellen für sexualisierte Gewalt ein.
- Sollte der*die Täter*in der Kirche haupt-, neben- oder ehrenamtlich arbeiten, dann bitten Sie das Opfer um das Einverständnis, ein kirchliches Ermittlungsverfahren einzuleiten. Lassen Sie sich in diesem Fall von der seelsorgerlichen Schweigepflicht entbinden.
- Kirchliche Ermittlungsverfahren unterliegen keiner Verjährungsfrist.
- Machen Sie deutlich, dass ein Ermittlungsverfahren nötig ist, um andere mögliche Betroffene zu schützen.
- Melden Sie den Vorfall der Superintendentin / dem Superintendenten und nehmen Sie Kontakt mit der Ansprechstelle der EKM zum Schutz vor sexualisierter Gewalt
- Vergessen Sie nicht, dass Vorfälle sexualisierter Gewalt durch kirchliche Mitarbeitende, egal ob haupt- oder ehrenamtlich, immer auch die ganze Gemeinde betreffen. Gemeindeberatung zur Aufarbeitung kann dringend notwendig werden.
Und bei allem bedenken Sie: Der Schutz der Betroffenen hat oberste Priorität. Nichts geschieht gegen den Willen der Betroffenen.
4. Falldokumentation
Die sofortige schriftliche Dokumentation bei einer Vermutung von sexualisierter Gewalt gegen Schutzbefohlene ist unbedingt notwendig. Fakten, Beobachtungen, eigene Gefühle sind nach einiger Zeit nicht mehr so exakt präsent, wie unmittelbar nach einem Vorfall.
Zu dokumentieren ist auch die Situation des Gesprächs. Die Aussagen sind möglichst wörtlich aufzuschreiben. Die Dokumentationen müssen fortgesetzt werden, wenn neue Informationen verfügbar sind oder Schritte zur Bearbeitung eingeleitet wurden. Der Grundsatz der Vertraulichkeit ist bei allen Gesprächen und Dokumentationen zu beachten. Aufzeichnungen sollen handschriftlich und dokumentenecht sein. Auf jeder Seite sollte der Name des Verfassenden, Datum, Ort, Uhrzeit stehen, die Seiten sollten nummeriert sein.
Dokumentationen müssen für Dritte unzugänglich aufbewahrt werden. Diesbezügliche Aufzeichnungen sind unverzüglich zu löschen, insofern sich Verdachtsmomente als falsch herausstellen. Bei der Dokumentation müssen objektive Fakten von subjektiven Eindrücken, Interpretationen, Reflexionen erkennbar getrennt werden. Die Sach- und Reflexionsdokumentation soll getrennt voneinander an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

DOWNLOAD
-
240912_Falldokumentation - (17.09.2025 / 50 KB)
-
240912_Beobachtungsdokumentation - (17.09.2025 / 49 KB)
-
2409_Interventionsplan_angepasst - (17.09.2025 / 81 KB)

